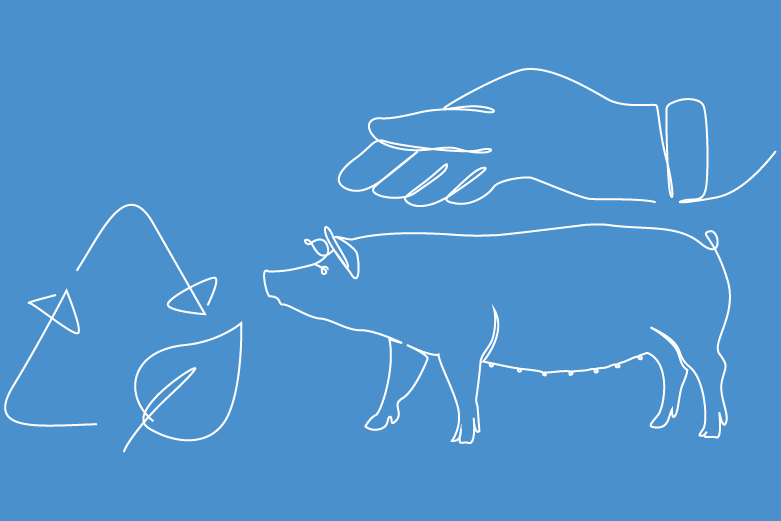Die Schweineproduktion hat Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere durch Treibhausgasemissionen (Klimawandel) und Nährstoffeinträge in Böden und Gewässer (Eutrophierung). Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Futterverwertung – also wie effizient ein Schwein Futter in Fleisch umwandelt. Diese Effizienz hängt von verschiedenen Zuchtmerkmalen wie Wachstumsrate, Futteraufnahme und Wurfgröße ab.
PIC entwickelt durch gezielte Zuchtprogramme kontinuierlich genetische Verbesserungen, die nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Umweltbilanz der Schweineproduktion optimieren. Um diesen Effekt zu messen, wurden zwei Umweltbilanz-Analysen (Life Cycle Assessments, LCA) durchgeführt:
- Zukunftsprognose bis 2030: Eine Studie verglich den ökologischen Fußabdruck von Schweinen im Jahr 2021 mit den prognostizierten Werten für 2030. Das Ergebnis: Durch genetische Fortschritte kann die Umweltbelastung um 7–9 % reduziert werden.
- Vergleich mit dem Branchendurchschnitt: Eine zweite Analyse untersuchte, wie sich Schweine mit PIC-Genetik im Vergleich zum nordamerikanischen Durchschnitt schlagen. Die Ergebnisse zeigen, dass PIC-Schweine eine um 7–8 % geringere Umweltbelastung aufweisen.
Diese Studien belegen, dass die Zuchtziele von PIC nicht nur auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet sind, sondern auch zu einer nachhaltigeren Schweineproduktion beitragen. Mit fortschreitender genetischer Entwicklung und neuen Technologien wird dieser positive Effekt weiter zunehmen.
PIC’s Kommentar
Juan Manuel Herrero, Genetic Service, und Pablo Magallon, Technical Services, PIC Südeuropa
Die landwirtschaftlichen Lieferketten arbeiten daran, ihre Klimaziele zu erreichen – meist durch praktikable Strategien, die Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Produktivität und Rentabilität fördern. Während genetische Zuchtprogramme traditionell mit einer höheren Produktivität und Wirtschaftlichkeit in der Agrar- und Lebensmittelindustrie in Verbindung gebracht wurden, ist ihr positiver Einfluss auf die Umweltbilanz weit weniger bekannt.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass genetische Fortschritte in der Schweinezucht nicht nur Treibhausgasemissionen, den Ressourcenverbrauch und die Abfallmengen reduzieren, sondern dass diese positiven Effekte auch glaubwürdig und nachvollziehbar durch eine Lebenszyklusanalyse (LCA) gemäß ISO-Norm quantifiziert werden können.
Der nächste Schritt für die Anwendung in der Schweinebranche wäre die Entwicklung eines Rahmens, der es den zentralen Akteuren der Branche ermöglicht, CO₂-Reduktionen zu zertifizieren und auszuweisen. Diese Arbeit stellt einen wichtigen Schritt hin zu einem größeren Ziel dar: standardisierte und verlässliche Methoden zur Messung, Verifizierung und Berichterstattung von Emissionsreduzierungen in der Schweineproduktion zu schaffen.
In Zukunft werden Umweltverbesserungen durch Technologien wie die genetische Zucht als zusätzlicher Wert für das Produkt betrachtet – sowohl für lebende Schweine als auch für Fleisch und Nebenprodukte. Diese Studie legt somit die Grundlage dafür, dass die Schweinebranche ehrgeizige Klimaziele verfolgt und neue, monetarisierbare Produktmerkmale für Landwirte schafft.
Dieser Artikel ist im Original in der spanischen Fachzeitschrift SUIS erschienen.